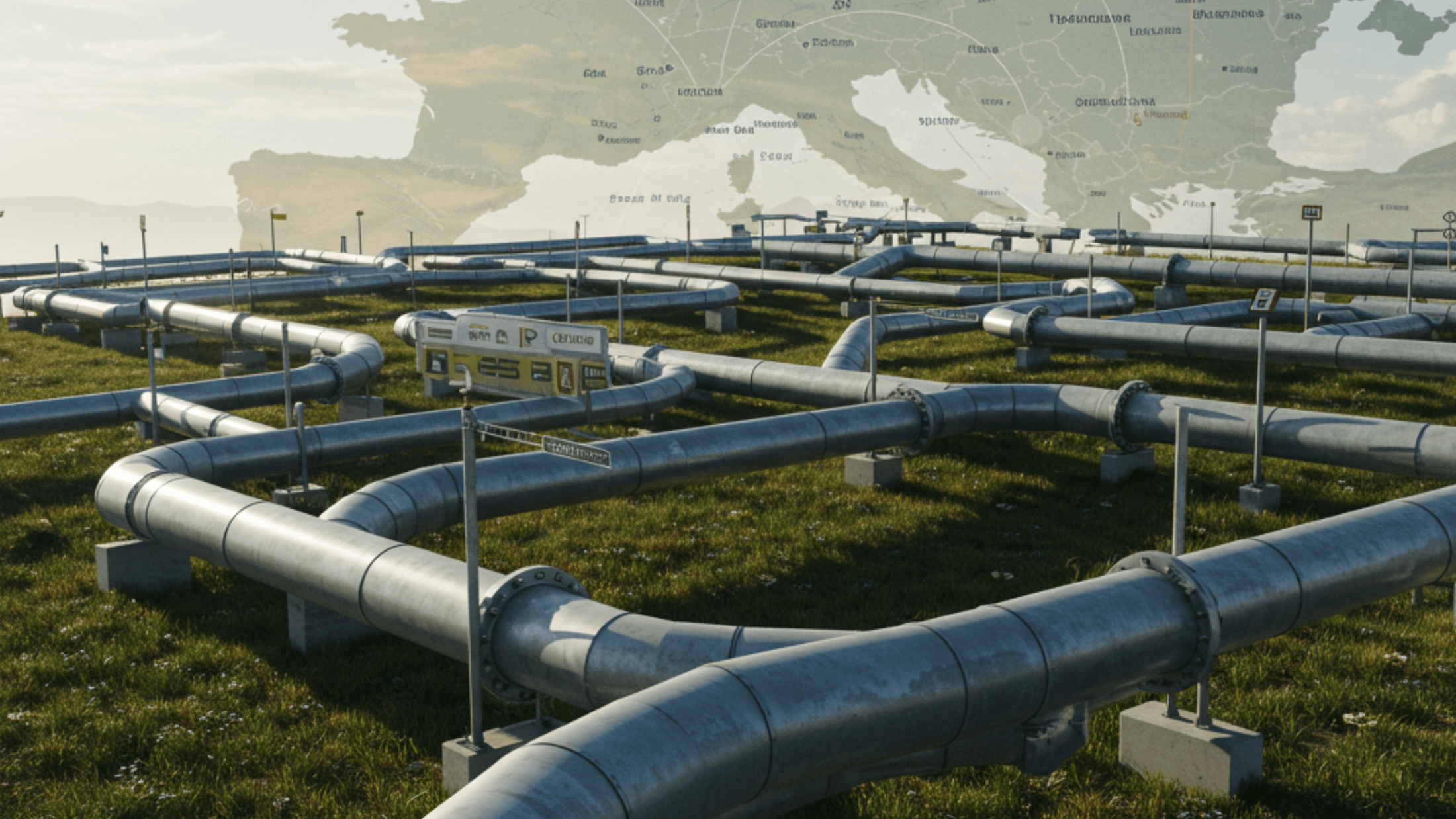762 KB
Diese Studie widmet sich den potenziellen Folgen einer Wiederherstellung des Transits von russischem Erdgas durch die Ukraine – ein Szenario, das zunehmend im Kontext künftiger Friedensgespräche zwischen Kyjiw und Moskau diskutiert wird. Das Ziel der Forschung ist es, zu bewerten, ob ein solcher Schritt den nationalen Interessen der Ukraine sowie den übergeordneten Prioritäten Europas im Bereich der Energiesicherheit entsprechen würde.
Nach dem Auslaufen des Gastransitabkommens zwischen dem ukrainischen Energieunternehmen „Naftogaz“ und dem russischen „Gazprom“ im Jahr 2019 hat die Ukraine am 1. Januar 2025 offiziell den Transit von russischem Gas in die EU eingestellt. Diese Entscheidung markierte einen Wendepunkt in der europäischen Energielandschaft.
Obwohl die Einstellung des Transits für die Ukraine wirtschaftliche Verluste bedeutete, schwächte sie zugleich die Positionen der Russischen Föderation auf dem europäischen Energiemarkt erheblich. Dies reduzierte außerdem die Möglichkeiten des Kremls, Energieressourcen als politisches Druckmittel einzusetzen.
Geopolitische Veränderungen: Die russische Aggression gegen die Ukraine sowie die Bemühungen der EU zur Diversifizierung der Lieferquellen führten zu einem Rückgang des Anteils russischen Gases am EU-Import von 41 % im Jahr 2020 auf 9 % im Jahr 2023. Die Einstellung des Gastransits durch die Ukraine Anfang 2025 hatte keine gravierenden Auswirkungen auf die Energiesicherheit der EU, entzog der Russischen Föderation jedoch wichtige Einnahmen aus dem Gasverkauf.
Wirtschaftliche Auswirkungen für die Ukraine: Die Einstellung des Transits kostet die Ukraine bis zu 1 Mrd. US-Dollar pro Jahr an entgangenen Einnahmen. Zudem sind die Gasreserven im April 2025 nahezu 0,7 Mrd. m³ infolge eines Rückgangs der inländischen Förderung durch russische Angriffe gefallen. Daher steht die Ukraine aktuell vor steigenden Kosten für Gasimporte.
Alternative Transitszenarien: Diskutiert werden Szenarien wie die Nutzung von aserbaidschanischem Gas, die direkte Buchung von Transitkapazitäten durch europäische Unternehmen oder eine strategische Zusammenarbeit bei der Gasspeicherung in den ukrainischen Untergrundspeicheranlagen. Jedes dieser Szenarien stößt jedoch auf technische, rechtliche oder geopolitische Hürden.